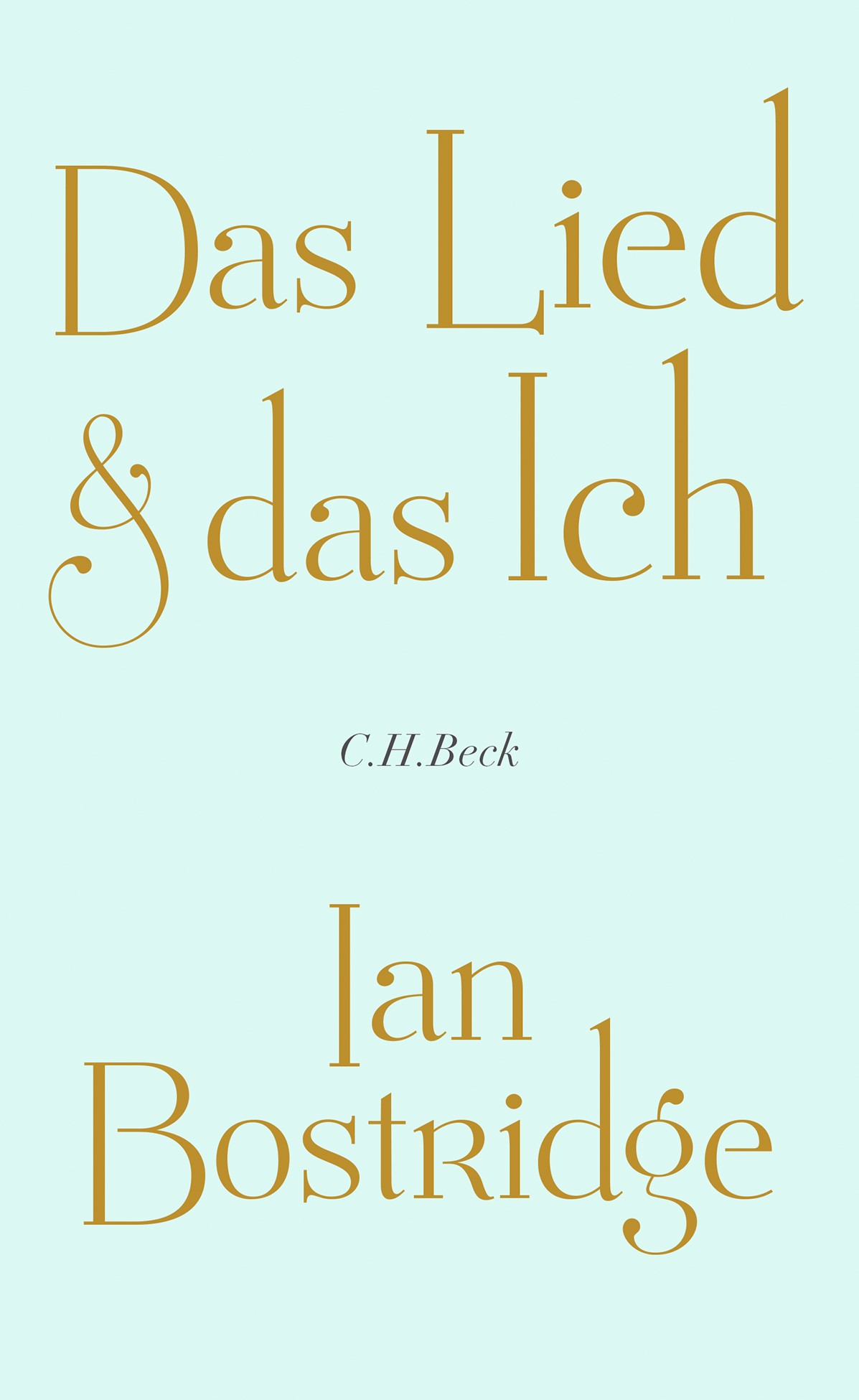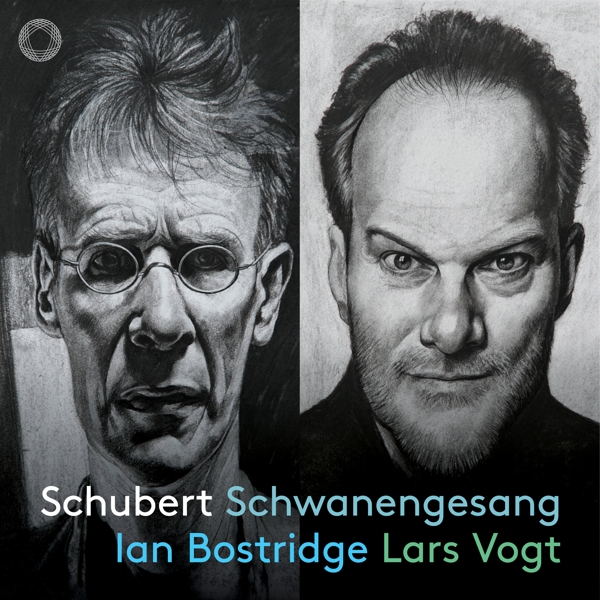Herr Bostridge, in Ihrem neuen Album haben Sie sich für Werke aus einer Zeit entschieden, in der der Tenorpart noch eine eher kleinere Rolle in der Oper spielte. Warum?
Ian Bostridge: Natürlich waren die Kastraten die wahren Stars jener Zeit, aber auch in dieser frühen Epoche gab es durchaus schon große Tenorsänger. Man denke nur an Annibale Pio Fabri, Antonio Borosini oder auch John Beard in England. Ebenso gab es auch schon großartige Rollen für dieses Fach: von Monteverdis Orfeo gleich zu Beginn des 17. Jahrhunderts – die Rolle hatte er für Francesco Rasi geschrieben – bis hin zu Bajazet in Händels „Tamerlano“ im 18. Jahrhundert mit Borosini. Für mich ist das Interessante an diesen speziellen Arien, dass sie einen Stil des Tenorgesangs zeigen, der in gewisser Weise sogar vielfältiger ist als das, was wir gewohnt sind.
Inwiefern?
Bostridge: Wir hängen heute so sehr an diesem spektakulären, brillierenden Tenorbild. Pavarotti war wahrscheinlich der größte Tenor des 20. Jahrhunderts, vielleicht sogar aller Zeiten. Aber das gilt nur für die quasi „neu erfundene“ Tenorstimme. Etwa ab den 1820er Jahren konzentrierte man sich weniger auf das Florale, weniger auf Koloraturen, sondern mehr auf Kraft und auf hohe Töne. Für das Publikum führt das natürlich zu aufregenden, hochdramatischen Höhepunkten, allerdings gerät das Musikalische dabei häufig ein wenig in den Hintergrund. Denn das hohe H in „Nessun dorma“ zu singen und möglichst lange zu halten ist in etwa so, als würde man ein Tor beim Fußball schießen. Es hat beinahe etwas von einer sportiven Sichtweise auf die Musik. Aber diese Sichtweise ist mir persönlich sehr fremd.
Was ist bei den frühen Arien auf Ihrem Album anders?
Bostridge: Diese frühen Arien haben dagegen eine gewisse Intimität und Subtilität. Man hat sogar die Möglichkeit, sie auf eine Art zu singen, die ein bisschen mehr an Jazz erinnert. Bei dieser Musik gibt es so viele Möglichkeiten, um Farben durch Worte zu erzeugen. Die interessanteste Jazzsängerin ist für mich heute Cécile McLorin Salvant. Sie wurde ursprünglich im französischen Barockgesang ausgebildet. Ich denke also, dass es da faszinierende Überschneidungen gibt.
Sie haben insgesamt ein sehr breitgefächertes Repertoire. Wie sehr hängt Ihre Werkauswahl auch von der Wahl der musikalischen Partner ab?
Bostridge: Sehr sogar. Das ist eine der großen Freuden an dieser Arbeit, wirkliche Profis um sich zu haben und immer mit neuen Musikern arbeiten zu können. Ich habe zum Beispiel vor etwa fünf Jahren angefangen, mit Saskia Giorgini zu arbeiten. Sie schlug vor, sich mit den Liedern von Respighi zu beschäftigen. Das war eine komplette Neuentdeckung für mich, und am Ende wurde daraus sogar eine CD. Auch die Arbeit mit den vielen verschiedenen Dirigenten und Orchestern – sie alle haben ihren ganz eigenen Klang und der bringt auch ganz verschiedene Dinge in der eigenen Stimme hervor.
Eröffnen sich dann auch neue Perspektiven bei Stücken, die Sie schon gut kennen?
Bostridge: Auf jeden Fall. Man reagiert ja stetig aufeinander. Das passiert gar nicht unbedingt bewusst, und häufig zeigt sich die Auswirkung erst bei der Aufführung. Selbst bei der „Winterreise“, die ich in- und auswendig kenne, ist es immer toll, von einem Pianisten vor neue Herausforderungen gestellt zu werden oder andere Phrasierungen zu finden, auf die man dann reagieren muss.
Schuberts „Winterreise“ haben Sie bereits mehrmals eingespielt, 2015 haben Sie sogar ein Buch darüber veröffentlicht. Warum ist dieser Liederzyklus so wichtig für Sie?
Bostridge: Die „Winterreise“ ist einfach unendlich suggestiv. Es ist eines dieser Werke, die eigentlich nicht auf dem Notenpapier stattfinden, denn es gibt so viel zwischen den Noten zu entdecken. In jedem Lied lässt sich eine Art Verbindung zu den Grundbedürfnissen unserer Kultur herstellen, sowohl zu Schuberts Zeit als auch heute. Kein anderer Liederzyklus ist in dieser Weise so historisch bedeutsam.

Kommen Sie irgendwann an den Punkt, an dem Sie sagen können: Das war meine letzte „Winterreise“, ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen?
Bostridge: Ich hoffe nicht! Es gibt eine sehr berühmte „Winterreise“ mit dem irischen Sänger Harry Plunket Greene, die mich immer sehr gerührt hat. Ich glaube, er war zu dem Zeitpunkt der Aufnahme über achtzig. Als Sänger wird man häufig gefragt, wie lange man denn wohl noch so weitermachen kann. Mein Gesangslehrer hat mir erklärt, dass man die Stimme durchaus noch mindestens bis in die Siebziger entfalten kann. Ich freue mich also darauf, meine Stimme in den nächsten zwanzig Jahren weiterzuentwickeln, zu verändern und neue Farben darin zu finden.
Sie kommen ursprünglich aus dem wissenschaftlichen Bereich, schreiben immer noch regelmäßig Forschungsbeiträge. Wie sehr beeinflusst Sie Ihre wissenschaftliche Ader als Künstler?
Bostridge: Insgesamt nur sehr wenig, denke ich. Wobei es durchaus Repertoire gibt, in das ich bei den Vorbereitungen geistig sehr tief eindringe. Dann gibt es wieder Stücke, bei denen ich einfach nur die Noten auf dem Blatt verbinde. Ich weiß nicht genau, warum das mal so, mal so ist. Letztendlich kann man sich ohnehin so viel vorbereiten, wie man will: Was einen großartigen Auftritt wirklich ausmacht, ist, dass man für die Sache brennt und den Auftritt lebt. Wenn es einem nur darum geht, schön zu singen, oder entspannende Musik für das Publikum zu spielen, hat das keine Qualität. Es muss um viel mehr gehen. Das klingt vielleicht prätentiös, aber man muss das Publikum wirklich packen und aufrütteln.
Glauben Sie denn, dass wissenschaftliches Denken einer subjektiven künstlerischen Darstellung im Wege steht?
Bostridge: Nein, so wie ich auch nicht glaube, dass das Intellektuelle dem Emotionalen fremd ist. Die Fuge beispielsweise ist eine der intellektuellsten Formen in der Musik, und wir kennen Bachs Brillanz bei der Schaffung von Fugen. Diese Musik kann uns trotzdem berühren. Auch die beiden Fugen am Ende des letzten Satzes von Beethovens Klaviersonate op. 110 sind im Grunde sehr ausgefeilte, handwerkliche Übungen, aber wenn sie dann zusammengeführt werden, verbinden sie sich zu einem der bewegendsten musikalischen Momente überhaupt.
Sie haben einmal geschrieben, dass wir Komponisten und ihr Schaffen nicht verstehen können, ohne uns mit ihrer Bindung an die Welten von Emotionen, Ideologien oder Sachzwängen auseinanderzusetzen.
Bostridge: Ich denke, wir können einem Stück nicht wirklich auf den Grund gehen, indem wir nur die technische Oberfläche untersuchen. Man sollte auch verstehen, was alles in die Entstehung des Werks eingeflossen ist. Musik zu komponieren ist eine ausdrucksstarke Tätigkeit. Natürlich konnte Schubert, als er im Sterben lag und elendig unglücklich war, trotzdem eine fröhliche Musik schreiben, ganz einfach weil er ein professioneller Komponist war. Aber gleichzeitig glaube ich nicht, dass man den späten Werken Schuberts eine Art existenziellen Input absprechen kann.
Bleibt denn da noch genügend Platz für Subjektivität oder geht das schon mehr in Richtung historisch informierte Aufführungspraxis?
Bostridge: Historisch informierte Praxis hat auf jeden Fall ihre Berechtigung. Aber ich denke, beim Musikmachen geht es gar nicht um diese historische Authentizität. Wir führen die Musik für das Publikum auf, nicht für den Komponisten. Natürlich muss man auch dessen Absichten berücksichtigen, aber gleichzeitig lesen wir manchmal Dinge aus den Werken heraus, von denen der Komponist nicht die leiseste Ahnung hatte. Es gibt kein Stück, das für sich allein existiert, sondern sie alle entstehen erst durch die Interaktion zwischen dem Publikum und dem Interpreten.
Gibt es etwas, was Sie schon immer singen wollten, aber bisher noch nicht geschafft haben?
Bostridge: Antonio Pappano hat mich vor etwa zwanzig Jahren zum ersten Mal auf den Gedanken gebracht, den ich seitdem nicht mehr los geworden bin: Ich würde wirklich gerne mal den Loge singen. Es ist eine wirklich faszinierende Rolle, die sehr gut zu meiner Stimme passt. Aber es hat sich noch nicht ergeben, und ich hoffe, dass ich das vielleicht nach der Pandemie einmal tun kann.