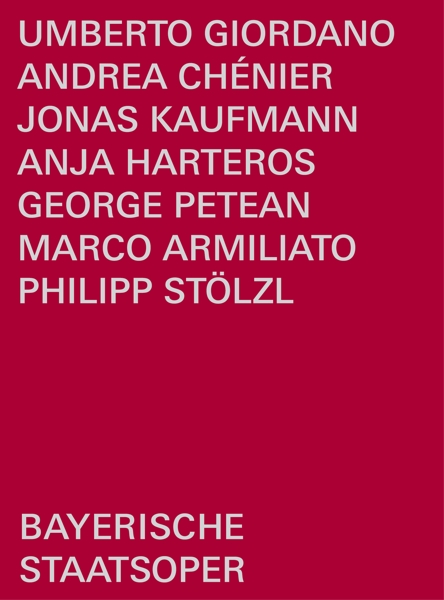Opernfans verehren sie, ja, liegen ihr zu Füßen. Und Kritiker schwelgen in Superlativen: Anja Harteros sei die Opernkönigin – ihre Stimme gehe zu Herzen – ihren wunderbar warmen und weichen Sopran lasse sie auf endlosem Atem durch die Partitur strömen. Und in der Tat adelt sie Opernfiguren mit ihrer Ausnahmestimme und Bühnenpräsenz. Bei den Münchner Opernfestspielen gibt die große Sängerin, die sich eine angenehme Bescheidenheit bewahrt hat und mit der „Divenchose“ so gar nichts anfangen kann, nun in einer Paraderolle ihr Debüt: der Arabella.
Die Arabella und die Marschallin von Strauss oder Verdis große Sopranpartien singen Sie derzeit nahezu konkurrenzlos. Haben Sie als Studentin von einer solchen Karriere geträumt?
Anja Harteros: Oh, vielen herzlichen Dank für das schöne Lob! Nein, ich habe nie von solch einer Karriere geträumt. Ich habe mir eigentlich nie Gedanken gemacht, wie alles laufen sollte. Nur wollte ich immer eine gewisse Qualität erreichen, und dazu muss man eben auch mit den besonders guten Kollegen unter den guten zusammenarbeiten dürfen – und das hat mich immer angetrieben. Ich wollte mich weiterentwickeln, die Musik erfüllen können.
Nun hängt solch eine Erfüllung ja bei einer Sängerin nicht allein von Ihnen ab – wie wichtig ist Ihnen ein Dirigent, der sein Orchester „erzieht“?
Harteros: Sehr wichtig! Das Problem ist wohl auch, dass die Klanggewohnheit uns viele ungesunde Eigenheiten erlaubt, weil wir leicht in den Glauben verfallen, dass gewisse Unarten Ausdruck seien. Ich denke auch, die vielbeschworene Italianità ist eher ein Mythos als real. Natürlich passt nicht jede Stimmfarbe in die Musik von Verdi, aber das gilt für Mozart ebenso, wie auch für jeden anderen Komponisten. Zudem wird gern Lautstärke mit Temperament verwechselt und behäbige Stimmen wie auch besonders langsame Tempi mit Italianità. Für mich wesentlich ist ein gesunder Gefühlshaushalt, der die Mischung zwischen der Anforderung rein technischer Art und der relativ direkten Emotion bei Verdi ausbalancieren kann.
Vor kurzem haben Sie in Rom Verdis „Aida“ erstmals gesungen – für eine Live-CD-Produktion. Wann folgt das szenische Debüt?
Harteros: Eigentlich hatte ich entschieden, die Rolle gar nicht zu singen – das war lange vor der Aufnahme – und hatte mich darum auch nicht weiter damit beschäftigt. Diese Rolle ist ja so behaftet mit Klischees wie kaum eine andere – vielleicht ähnlich wie bei Norma oder Tosca; aber das sagt ja nichts über die Rollen selbst aus. Ich mag halt nur nicht diese vorurteilsbehaftete Divenchose, denn mal ganz ehrlich, es gibt auch andere schwierige Rollen. Wenn ich überhaupt über eine szenische Produktion nachdenken würde, wäre neben meiner eigenen Verfassung der Dirigent ein entscheidender Faktor – und gerne nähme ich dann auch ein akustisch vorteilhaftes Bühnenbild.
Haben sich hinsichtlich dieser Rolle die Geschmäcker verändert? Einst sangen eine Callas oder Tebaldi die Aida und galten als Referenz, bevor sich dann in den 70er und 80er Jahren erstmals Sopran-Lyrikerinnen an die äthiopische Prinzessin gewagt haben.
Harteros: Wir meinen heute oft, richtig sei, wie in den 50er und 60er Jahren gesungen wurde, und wollen es genau so hören – und vielleicht auch sehen. Aber ich glaube, auch das ist in gewisser Weise ein Irrtum, denn Verdi hat zu dieser Zeit ja auch nicht mehr gelebt, man konnte ihn also damals nicht mehr fragen. Ich weiß nicht, ob man tatsächlich eine Linie sehen kann: Dafür müsste man wohl nicht nur diese Referenzsängerinnen betrachten, die ich alle sehr bewundere und verehre, kein Zweifel – dennoch gab es ja doch schon sehr viele Interpretinnen dieser Rolle. Und vergessen wir auch nicht die Beweggründe einer Sängerin, eine Rolle ins Repertoire auf- zunehmen: Nicht immer geht es da um die Interpretation der Rolle, sondern oft auch um die eigene Selbstdarstellung und die Etablierung in einem bestimmten Bereich der öffentlichen Wahrnehmung.
Für letztere könnten Sie die „ewige Elsa“ sein und sich gleichsam dem geruhsamen Künstler-Jetset zwischen München und Mailand hingeben. Was treibt Sie an, trotzdem immer wieder neue Grenzen auszuloten?
Harteros: Ich habe die Elsa sehr gerne gesungen, aber ich habe entschieden, sie nicht über Gebühr oft zu singen. Warum? Elsa ist eine Rolle mit unvergleichlichem Zauber. Dieser Zauber muss zwangsläufig verloren gehen im routinemäßigen Betrieb. Das ist bei keiner anderen Partie so wie bei dieser. Und ich habe mit ihr etwas Einmaliges erleben dürfen, was sich wohl nicht wiederholen lässt, das ist innerlich geschehen, gehört aber der Vergangenheit an. Grundsätzlich aber könnte ich es natürlich leichter haben und auch mehr Geld verdienen, wenn ich mich auf bereits erarbeitete Partien beschränken würde: Also Elsa rauf und runter. Doch ich glaube einfach, mein Weg ist noch nicht ganz zu Ende …
Nehmen wir an, Sie erhalten parallele Anfragen für zwei Premieren zur selben Zeit. Wie entscheiden Sie sich: für die Produktion mit dem Traum-Regisseur oder für jene mit dem Traum-Dirigenten?
Harteros: Für den Traum-Dirigenten, weil ein Opernbesuch mit Ohrstöpseln weniger empfehlenswert ist als mit Augenklappe.
In den letzten Jahren wurde viel und kontrovers über das Regietheater diskutiert. Wo sehen Sie die Zukunft der Oper?
Harteros: Ich glaube, man sollte sich einen naiven Zugang zum Werk trauen, auch wenn wir ja schon meinen, alles zu wissen und zu kennen: Die Werke sind eben nicht neu. Ich denke, es werden bald mehr Opern komponiert werden, andere, neue. Obwohl ich oft genervt bin durch das viele Falsche, was regiemäßig gemacht wird, kann man die Zeit ja doch nicht zurückdrehen – und es wäre auch schrecklich, wenn man so gar nichts Neues zu sehen und zu tun bekäme. Aber ich frage mich oft nach dem Recht, welches uns eigentlich gestattet, den Anweisungen des Komponisten zu trotzen – und oft bin ich auch nicht gewillt, wissentlich Falsches zu lernen.
Opernfreunde sprechen gern davon, durch Gesang berührt zu werden: Das höchste der Gefühle ist die oft beschriebene Gänsehaut. Bleibt die Frage: Wie entsteht solch eine Emotion beim Singen?
Harteros: Ich denke, das geschieht mental, teilweise unbewusst, die Phantasie macht das – und dafür ist jeder selbst zuständig. Sie kann aber eben inspiriert werden durch die Ausführung der Musik und ihre direkte Wirkung – doch für diese braucht es eine Bereitschaft. Als Sängerin muss ich also unbedingt visionär gestalten, versuchen, eine Art Magie herzustellen, damit das Publikum davon vielleicht etwas spürt.
Einher damit geht im YouTube- Zeitalter der dramatisch gestiegene Erwartungsdruck, nur keine Fehler zu machen – wie begegnen Sie diesem?
Harteros: Es ist schon unangenehm, wenn man befürchten muss, peinliche Momente dokumentiert zu wissen. Aber, mein Gott, wir sind Menschen und Fehler gehören einfach dazu – und viele sind ja auch recht lustig! Ich denke, man muss auch über sich selbst lachen können und Vieles nicht gar so ernst nehmen. Eigentlich gehört man eh erst auf die Bühne, wenn man die Fähigkeit hat, sich auch mal schlecht zu präsentieren: Davon geht die Welt ja nicht unter. Es gibt natürlich ganz schrecklich verbohrte Menschen, die meinen, anonym im Internet boshafte Kommentare abgeben zu müssen, egal ob nun ein peinlicher oder ein guter Moment dokumentiert ist, aber die sagen damit ja nur etwas über sich selbst aus.
Bei den Primadonnen der Vergangenheit setzte sich das „Sänger-Sein“ im Privaten fort, mit zum Teil schlimmen Folgen wie bei Maria Callas. Trennen Sie Kunst und Leben?
Harteros: Ein Sänger ist auch nur ein Mensch. Dennoch glaube ich nicht, dass sich die Kunst vom Leben trennen lässt, oder das Leben von der Kunst: Das würde alles doch sehr banal werden lassen. Aber ich muss ja nicht mein Leben lang aktiv singen, denn das erfordert schon einige Einschränkungen – und ich freue mich auf die Zeit, die nachher kommt.